Wenn Autoren den Begriff „Aufklärung“ im Titel führen, liegt die Messlatte naturgemäß sehr hoch. Nicht wenige Leser – mich eingeschlossen – mögen dann an die Stunden in der Schule denken, als sie mit Kants aufklärerischem und revolutionärem Gedankengut in Berührung kamen. Doch ganz so weit gehen Ossi Urchs und Tim Cole in ihrem Buch “Digitale Aufklärung – Warum uns das Internet klüger macht” dann doch nicht – leider. 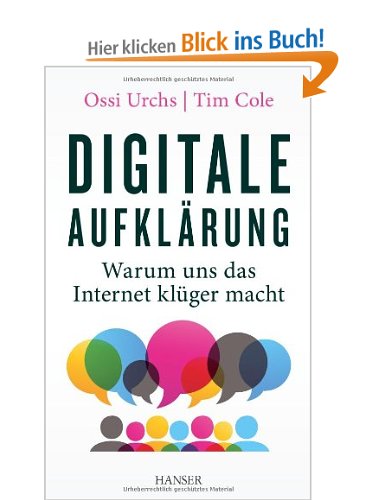
Stattdessen nehmen sich beide Stück für Stück populäre Veröffentlichungen (Schirrmacher, Spitzer) oder wissenschaftliche Erkenntnisse (Metcalfe, Moore) vor, um diese dann – je nach Nützlichkeit – in ihre Argumentationskette aufzunehmen oder zu widerlegen. Für den an Internet-Entwicklungen interessierten Leser kommt dadurch wenig Neues zutage – been there, read that. Aber auch die noch Nicht-Wissenden, die Skeptiker dürften nach der Lektüre nicht schlauer sein als zuvor. Wer nämlich noch nie vom Netz profitiert hat; es erlebt hat, wird sich auch von logisch klingenden Netzwerk- und Schwarmtheorien nicht überzeugen lassen.
Viel gewichtiger wirkt bei „Digitale Aufklärung“ jedoch der Umstand, dass es sich hier um eine reine Momentaufnahme handelt. Das mag bei den von den Autoren formulierten zehn Thesen noch durchgehen – nicht jeder ist gleich ein Kant – doch besonders kritisch wird es dann, wenn Fragen von Moral und Ethik gestreift werden. So führen Urchs und Cole die Gedanken von Christopher deCharmes ein, der mit den Maschinen seiner Firma Omneuron in der Lage sein will, neuronale Impulse aufzufangen – im Alltagssprech auch Gedankenlesen genannt.
Schon bald könnte das Gehirn nicht nur gelesen, sondern auch programmiert werden – was für Depressive und andere Kranke eine gute Nachricht ist, mag Arbeitnehmer und Soldaten weniger erfreuen. Die Autoren mahnen an dieser Stelle auch richtigerweise „die eigentlich längst fällige Diskussion um Regeln und Moral im Zeitalter digitaler Veränderung und Beschleunigung an“ und sehen in den neuen Techniken „auch ein hohes zerstörerisches Potenzial. Wenn wir es so weit kommen lassen, dann sind wir wirklich digitale Deppen“. Doch anstatt nun ethische und moralische Grundsätze zu entwickeln- wie es Buchtitel und die formulierten Thesen fordern , heißt es nur: „Auf solche Fragen sinnvolle Antworten zu finden wird die größte Aufgabe sein für die heranwachsende Generation“.
Fazit: Leider bleibt „Digitale Aufklärung“ hinter meiner (hohen) Erwartungen zurück. Die Schuhe von Kant waren doch mehr als eine Nummer zu groß. Was an philosophischen Gedanken fehlt, wird jedoch durch eine gute Übersicht über alle historischen und aktuellen Netz-Theorien und –Diskussionen wettgemacht. Darüber hinaus gibt es an der einen oder anderen Stelle auch wichtige Erkenntnisse; etwas dass die „Digital Natives“ keine Generation seien, da digitale Kompetenz nicht mit dem biologischen Alter zusammenhänge.
